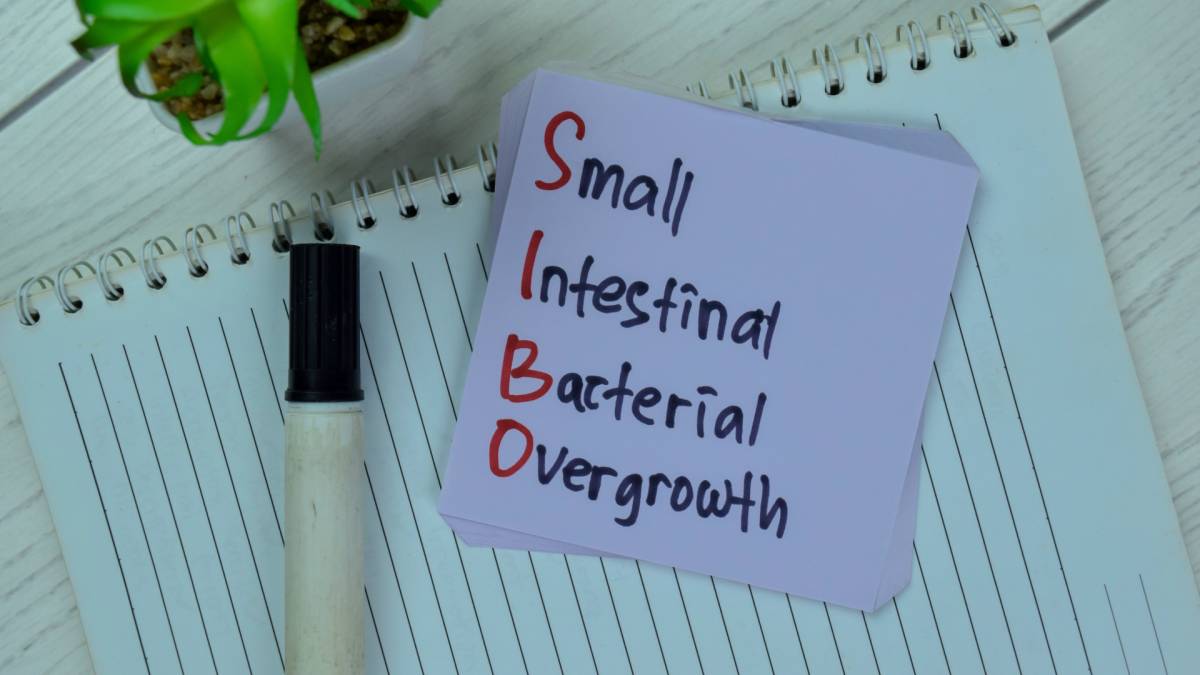
BLOGARTIKEL
SIBO-Guide – Symptome, Diagnose und Ernährung bei Dünndarmfehlbesiedlung
7. September 2025
Vielleicht bist Du auf den Begriff “SIBO” im Rahmen einer typischen “Doktor Google”-Recherche gestoßen; vielleicht hast Du es auch von Deinem Arzt, Deiner Heilpraktikerin oder jemand anderem aus Deinem Umfeld gehört. Wie auch immer Du auf das sogenannte “Small Intestinal Bacterial Overgrowth” Syndrom – auf Deutsch: Dünndarmfehlbesiedlung – gestoßen bist, womöglich lassen sich dadurch Deine Probleme mit Deiner Verdauung erklären.
In diesem Artikel erfährst Du, was SIBO genau ist, wie es vermutlich entsteht und welche Symptome damit vergesellschaftet sind. Wir zeigen Dir ebenfalls die bisherigen Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten auf. Wie immer wünschen wir Dir viel Spaß beim Lesen, und falls Du Anregungen oder Fragen hast, freuen wir uns auf Deine Nachricht: support@mibiota.de
Hinweis: Wie immer sind die Informationen in unserem Artikel von uns selbst recherchiert und geschrieben – ohne Beteiligung von ChatGPT und Konsorten. Viel Spaß beim Lesen!
Was ist SIBO genau?
SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth) ist schlicht und einfach eine bakterielle Überwucherung des Dünndarms. Im Gegensatz zu Keimen, an die man bei Bakterien vielleicht eher denkt, handelt es sich nicht um eine klassische Infektion mit Krankheitserregern, sondern vielmehr um eine Besiedlung mit eigentlich normalen Darmbakterien – also Bakterien, die in einem gesunden Verdauungstrakt üblicherweise zu finden sind.
Allerdings haben sich bei SIBO diese Bakterien am falschen Ort angesiedelt. Normalerweise leben die meisten Mikroorganismen im Dickdarm. Bei SIBO jedoch kommt es zu einer vermehrten Ansiedlung von Mikroben im Dünndarm, wo sie physiologisch (also im gesunden Zustand) nur in geringer Zahl vorhanden sein sollten. Wichtig zu verstehen ist also, dass die Bakterien, die sich angesiedelt haben, nicht generell “schlecht” oder “böse” sind, sie gehören nur in dieser Menge nicht in den Dünndarm.
Um diesen Zusammenhang besser nachzuvollziehen, lohnt sich ein Blick in die Verteilung von Mikroorganismen im Verdauungstrakt:
-
Mundhöhle
Die ersten Bakterien – auch “gute” – befinden sich schon im Mund. Denn auch unser Mund verfügt über ein eigenes Mikrobiom, und es existiert auch eine Mund-Darm-Achse.
-
Ösophagus und Magen
Hier befinden sich wenige Bakterien, im Magen überleben nur spezielle säureresistente Stämme. Krankheitserregende Darmbakterien wie E. coli aktivieren Schutzmechanismen, um im sauren Milieu des Magens zu überleben.
-
Dünndarm & Dickdarm
Die Menge an Mikroorganismen im Dünndarm liegt bei etwa 1.000 bis 10.000 (10³ bis 10⁴) Keimen pro Milliliter – im Gegensatz dazu leben im Dickdarm etwa 10¹¹-10¹² Bakterien pro Gramm Darminhalt (siehe Box für mehr dazu). Die Größenordnungen werden also schnell deutlich. Bei SIBO verschiebt sich dieses Verhältnis und es befinden sich mehr Bakterien im Dünndarm – die Zahl steigt auf 10⁵ bis 10⁶ pro ml oder sogar darüber hinaus. Und genau dadurch wird SIBO definiert, denn das ist das diagnostische Kriterium laut Definition der ICD-10-Klassifikation durch die Weltgesundheitsorganisation (K63.82 für die Gruppe mit Untergruppencodes).
10¹¹-10¹² Bakterien pro Gramm Darminhalt – womit kannst Du das vergleichen?
- Stand September 2025 geht die Gesamtzahl aller Videoaufrufe auf YouTube in den 10¹²-Bereich.
- Im menschlichen Körper befinden sich ca. 10¹¹ bis 10¹² Kilometer DNA, wenn man alle Zellen zusammenrechnet – wenn man sie entrollen würde.
Wie kommt es zur Entstehung von SIBO?
Die Entstehung ist wie bei anderen Darmerkrankungen noch nicht vollends geklärt und scheint auch multifaktoriell zu sein – das bedeutet, es gibt vermutlich mehrere Ursachen, die auch gleichzeitig vorliegen können.
Zum einen kann SIBO auf dem Boden anderer Erkrankungen oder Eingriffen entstehen – denn der Darm interagiert mit dem Rest des Körpers und wird im Umkehrschluss auch von ihm beeinflusst:
- So zeigt sich beispielsweise ein Zusammenhang zwischen dem Auftreten von SIBO und Erkrankungen wie Leberzirrhose, Herzinsuffizienz, Diabetes, Niereninsuffizienz, Schilddrüsenunterfunktion und auch neurologischen Erkrankungen wie Parkinson1,2,3.
- Auch mit anderen Darmerkrankungen wie der Helicobacter pylori Infektion, dem Reizdarmsyndrom oder chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (besonders Morbus Crohn) wird SIBO assoziiert1.
Weitere Ursachen und Mechanismen für die Entstehung von SIBO
- verminderte Darmmotilität (medikamentenbedingt oder krankheitsbedingt sowie bei unausgewogener, ballaststoffarmer Ernährung)
- verminderte Magensäureproduktion
- eine beeinträchtigte Ileozäkalklappe (das ist die Verbindung und gleichzeitig Trennung zwischen Dünndarm und Dickdarm; ein niedriger Druck ist assoziiert mit SIBO4)
- Medikamente, zum Beispiel Protonenpumpeninhibitoren (bekannt als “Magenschutz”) oder auch ein Magensäuremangel anderer Ursache
- Alkohol und andere Drogen
- Operationen, Strahlentherapie und Co.
- etwas unspezifischer, aber als Einfluss nicht zu vernachlässigen: Ernährung, Stress, Umweltbelastung, und ein bisschen Genetik ist mit Sicherheit auch dabei
Wichtig zu betonen ist, dass die Beziehung zwischen SIBO und anderen Erkrankungen bidirektional ist, das heißt, SIBO kann obige und weitere Symptome und Pathologien begünstigen und andersherum. Du kannst es Dir so ähnlich vorstellen wie bei Huhn und Ei – was zuerst kam, wissen wir nicht, wenn beides einmal da ist.
Das alles kann die Funktion des Darms beeinträchtigen und dadurch die typischen SIBO-Symptome verursachen – welche das sind?
Mit welchen Symptomen wird SIBO in Verbindung gebracht?
Die Symptome einer Dünndarmfehlbesiedlung sind vielfältig und überschneiden sich häufig mit anderen Erkrankungen wie dem Reizdarmsyndrom (RDS).
Die Symptome entstehen vor allem durch die bakterielle Fermentation von Nahrungsbestandteilen im Dünndarm, was zu einer verstärkten Gasbildung, Entzündung und Störung der Nährstoffaufnahme führen kann.
Beispiele typischer SIBO-Symptome
- Blähungen (häufig bereits kurz nach dem Essen)
- Meteorismus (sichtbarer Blähbauch durch Gasansammlungen)
- Bauchschmerzen und Druckgefühl, v. a. im Mittel- und Oberbauch
- Aufstoßen und vermehrte Gasbildung
- wechselhafter Stuhlgang, unter anderem Durchfälle (osmotisch bedingt), Verstopfung (v. a. bei methanbildenden Mikroben), Mischformen und Fettstühle (voluminös, glänzend, schwer zu spülen)
- Übelkeit und Völlegefühl, v. a. nach fettreichen Mahlzeiten
- Nahrungsmittelunverträglichkeiten (v. a. FODMAPs)
- Verdauungsrückstände im Stuhl
- chronische Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, „Brain Fog“
- ungewollter Gewichtsverlust
Bei FODMAPs handelt sich um Lebensmittel reich an fermentierbaren Oligo-, Di-, Monosacchariden und Polyolen – kurz gesagt, reich an leicht vergärbaren Kohlenhydraten und Zuckeralkoholen, die von manchen Menschen schlecht vertragen werden, was Symptome wie Blähungen, Bauchschmerzen und Durchfall verursachen kann. Die Low-FODMAP-Diät ist eine Ernährungsweise, die darauf abzielt, diese kurzkettigen Kohlenhydrate zu meiden und dadurch Beschwerden zu lindern.
Viele Patienten leiden auch an einer Malabsorptionsstörung, was bedeutet, dass wichtige Nährstoffe (z. B. Vitamin B12, Eisen, Fette, fettlösliche Vitamine) schlechter aufgenommen werden – das kommt besonders durch Schleimhautschäden und entzündliche Reaktionen im Dünndarm zustande.
Wusstest Du, dass viele Betroffene zunächst mit dem Verdacht auf Reizdarm diagnostiziert werden, obwohl sie eigentlich SIBO haben? Studien zeigen tatsächlich, dass bis zu knapp 50 % der Patienten mit Reizdarmsymptomatik ein potenziell zugrunde liegendes SIBO-Syndrom aufweisen5. Im Gegensatz zum Reizdarmsyndrom gibt es bei SIBO definierte Ursachen und klare Kriterien zur Diagnose – während Reizdarm mehr eine Ausschlussdiagnose darstellt.
Damit kommen wir schon zur Diagnostik – wie wird denn SIBO eigentlich nachgewiesen und worauf solltest Du achten?

Low-FODMAP Ratgeber bei Reizdarm und SIBO
Praktisch für’s Smartphone – ideal für Deinen nächsten Einkauf!
Der Weg zur SIBO-Diagnose – Atemtests, Verdauungsflüssigkeit und mehr
Der Goldstandard zum Nachweis von SIBO ist die Messung des Bakteriengehalts in der Dünndarmflüssigkeit. Das Aspirat muss über eine Endoskopie gewonnen werden und ist damit ein invasiver Eingriff. Unterstützend werden häufig Atemtests genutzt, die nach dem Verzehr einer Zuckerlösung (meist Laktulose oder Glukose) den Gehalt von bestimmten Gasen in der Atemluft messen. Diese Tests weisen zwar eine etwas geringere Sensitivität und Spezifität (siehe Box) auf, sind jedoch deutlich leichter durchzuführen.
Zufolge neuester Ergebnisse soll zusätzlich auch das Calprotectin im Stuhl, ein Wert, der primär zur Diagnose chronisch-entzündlicher Darmerkrankungen genutzt wird, auf SIBO hinweisen können6. Diese Erkenntnis zeigte sich bisher jedoch vor allem in Zusammenhang mit dem Krankheitsbild der systemischen Sklerose.
Sensitivität und Spezifität von Atemtests
- Sensitivität: Sie misst den Anteil der tatsächlichen Positiven, die korrekt als solche erkannt werden (hier: der Anteil der SIBO-Erkrankten, die durch den Atemtest korrekt als solche erkannt werden).
- Spezifität: Sie misst den Anteil der tatsächlichen Negativen, die korrekt als solche identifiziert werden (hier: der Anteil der nicht an SIBO-Erkrankten, die korrekt als nicht krank erkannt werden).
Die Diagnosekriterien der WHO richten sich nach dem Goldstandard: In der Dünndarmflüssigkeit muss die Konzentration an Darmbakterien mindestens 105 Zellen/ml betragen. Weiterhin wird in verschiedene Untergruppen von SIBO unterteilt.
Bestimmung der SIBO-Typen
Je nach Bakteriengattung, die den Dünndarm überwuchert, werden bei SIBO unterschiedliche Gase vermehrt produziert, die dann in einem Atemtest bestimmt werden können. In Abhängigkeit vom dominierenden Gas unterscheiden sich bei SIBO auch die Symptome. Folgende SIBO-Typen werden auf Basis der Ergebnisse eines Atemtests unterschieden:
-
Methandominante SIBO / IMO
Hier wird das Methan in den meisten Fällen nicht von Bakterien, sondern Archaeen produziert. Zudem ist in der Regel nicht allein der Dünndarm, sondern auch der Dickdarm befallen. Deswegen sprechen wir auch von IMO (Intestinal Methan Overgrowth). IMO wird häufig mit Verstopfung in Verbindung gebracht.
-
Wasserstoffdominante SIBO
Bei diesem Typ von SIBO verursacht der von den überwuchenden Bakterien produzierte Wasserstoff die Symptome aus. Diese SIBO-Form wird häufig von Durchfall begleitet.
-
Schwefelwasserstoff-SIBO
Dieser SIBO-Typ, auch H2S-Typ genannt, nimmt eine Sonderrolle ein, da sie dann angenommen wird, wenn im gesamten Atemtest keine erhöhte Konzentration eines Gases feststellbar ist. Hier kann eine Mikrobiomanalyse als weitere Testmethode mehr Klarheit verschaffen.
Bei der Diagnostik wendest Du Dich am besten an den Arzt oder die Ärztin Deines Vertrauens. Zusammen könnt Ihr am besten die Wahl der Methode die Art des Atemtests bestimmen. Was Du aber dann tun kannst und wie eine Therapie aussehen könnte, das besprechen wir jetzt.
Was hilft bei SIBO wirklich?
Die Behandlung von SIBO erfordert ein schrittweises Vorgehen, das auf mehreren Ebenen ansetzt – von der Ernährungsumstellung bis hin zur gezielten Therapie. Wichtig ist, dass Du auf Deine Symptome und Deinen Körper achtest, denn die Evidenz zur Behandlung von SIBO zeigt oft uneinheitliche Ergebnisse, eventuell wegen Unterschiede der Erkrankten.
Am Anfang steht die Symptomkontrolle. Die könnte zum Beispiel so aussehen:
-
1. Langsames, achtsames Essen mit vielen Pausen zwischen den Mahlzeiten
Wenn Du gut kaust und in Ruhe isst, aktivierst Du den sogenannten Parasympathikus – den Teil des Nervensystems, der bei der Verdauung aktiviert ist – und regelmäßige Pausen zwischen den Mahlzeiten (z. B. 4–5 Stunden) können helfen, die natürliche Darmbewegung zu fördern.
-
2. Kein Stress!
Auch wenn dies leichter gesagt als getan ist: Stressreduktion kann helfen, die Ausschüttung von Verdauungsenzymen zu fördern.
-
3. Nahrungsergänzungen
Enzymsupplementierung kann Dir dabei helfen, die Nährstoffaufnahme zu verbessern und Gärungsprozesse, bei denen Gase entstehen, zu vermindern.
-
4. Reduzierung von FODMAPs
Bestimmte Kohlenhydrate (FODMAPs) werden von den Bakterien im Dünndarm besonders leicht vergoren – die vorübergehende Reduktion kann helfen, die Symptome zu mindern.
Allein das ist langfristig oft nicht nachhaltig – denn die Ursache, die Fehlbesiedlung, bleibt noch bestehen. Im nächsten Schritt geht es also um eine Beseitigung der Bakterien, die “zu viel” sind.
Reduktion der Bakterien bei SIBO / Dünndarmfehlbesiedlung
Hierbei gibt es mehrere Ansätze, von Antibiotikagabe bis zu pflanzlichen Wirkstoffen, die das Bakterienwachstum hemmen können. Die natürliche Unterstützung bei SIBO findet beispielsweise mittels Pflanzenstoffe wie Knoblauchextrakte mit hohem Allicingehalt, Oreganoöl, Berberin, Zimt oder Schwarzkümmel statt. Die Evidenz hierzu steht aktuell zu großen Teilen noch aus, erste Ergebnisse sind jedoch erfreulicherweise positiv7,8. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass eine Kombination aus Antibiotikum (Rifaximin) und partiell-hydrolysiertem Guarkernmehl (PHGG), besser zu wirken scheint als eine alleinige Antibiotikagabe9.
Neben der Keimeradikation zur Reduktion der Bakterien im Dünndarm ist auch eine Unterstützung der Darmschleimhaut sowie der Verdauung wichtig. Während der Eradikation werden gleichzeitig die meisten “guten” Bakterien angegriffen, welche wichtige Stoffe zum Erhalt der Darmbarriere und der allgemeinen Gesundheit produzieren – es ist daher wichtig, den Darm und die Verdauung beispielsweise über sanftere Ballaststoffe zu unterstützen. Dazu zählen beispielsweise PHGG, Akazienfasern oder auch resistente Stärke. Weiterhin können einige Pflanzenextrakte reich an Polyphenolen10,11, oder auch L-Glutamin12 potenziell die Darmbarriere stärken, wobei letztere Empfehlung besonders auf Erfahrung basiert.
Besonders wichtig nach all dem ist es jedoch, Deinen Lebensstil auch nach der Beseitigung der Symptome gesund, reich an Ballaststoffen sowie möglichst stressarm zu gestalten, um Deinen Darm langfristig im Gleichgewicht zu halten.
Fazit: SIBO als komplexes Krankheitsbild mit viel Therapiepotenzial
SIBO ist komplex – und genau deshalb braucht es eine strukturierte, ganzheitliche Herangehensweise. Nicht jede Maßnahme ist für alle gleich sinnvoll, aber wenn Du Schritt für Schritt vorgehst, stehen die Chancen gut, dass Du langfristig wieder zu einem stabilen Verdauungssystem zurückfindest. Denn trotz teilweise unvollständiger Evidenz zeigen sich mehrere vielversprechende Möglichkeiten zur Besserung der Symptome bis hin zur Remission, die ebenfalls in einigen Studien erreicht werden konnte.
Referenzen (Englisch):
- Sroka, N., Rydzewska-Rosołowska, A., Kakareko, K., Rosołowski, M., Głowińska, I., & Hryszko, T. (2022). Show Me What You Have Inside-The Complex Interplay between SIBO and Multiple Medical Conditions-A Systematic Review. Nutrients, 15(1), 90. https://doi.org/10.3390/nu15010090
- Gunnarsdottir, S. A., Sadik, R., Shev, S., Simrén, M., Sjövall, H., Stotzer, P. O., Abrahamsson, H., Olsson, R., & Björnsson, E. S. (2003). Small intestinal motility disturbances and bacterial overgrowth in patients with liver cirrhosis and portal hypertension. The American journal of gastroenterology, 98(6), 1362–1370. https://doi.org/10.1111/j.1572-0241.2003.07475.x
- Song, Y., Liu, Y., Qi, B., Cui, X., Dong, X., Wang, Y., Han, X., Li, F., Shen, D., Zhang, X., Hu, K., Chen, S., Zhou, J., & Ge, J. (2021). Association of Small Intestinal Bacterial Overgrowth With Heart Failure and Its Prediction for Short-Term Outcomes. Journal of the American Heart Association, 10(7), e015292. https://doi.org/10.1161/JAHA.119.015292
- Roland, B. C., Ciarleglio, M. M., Clarke, J. O., Semler, J. R., Tomakin, E., Mullin, G. E., & Pasricha, P. J. (2014). Low ileocecal valve pressure is significantly associated with small intestinal bacterial overgrowth (SIBO). Digestive diseases and sciences, 59(6), 1269–1277. https://doi.org/10.1007/s10620-014-3166-7
- Poon, D., Law, G. R., Major, G., & Andreyev, H. J. N. (2022). A systematic review and meta-analysis on the prevalence of non-malignant, organic gastrointestinal disorders misdiagnosed as irritable bowel syndrome. Scientific reports, 12(1), 1949. https://doi.org/10.1038/s41598-022-05933-1
- Marie, I., Leroi, A. M., Menard, J. F., Levesque, H., Quillard, M., & Ducrotte, P. (2015). Fecal calprotectin in systemic sclerosis and review of the literature. Autoimmunity reviews, 14(6), 547–554. https://doi.org/10.1016/j.autrev.2015.01.018
- Redondo-Cuevas, L., Belloch, L., Martín-Carbonell, V., Nicolás, A., Alexandra, I., Sanchis, L., Ynfante, M., Colmenares, M., Mora, M., Liebana, A. R., Antequera, B., Grau, F., Molés, J. R., Cuesta, R., Díaz, S., Sancho, N., Tomás, H., Gonzalvo, J., Jaén, M., Sánchez, E., … Cortés-Rizo, X. (2024). Do Herbal Supplements and Probiotics Complement Antibiotics and Diet in the Management of SIBO? A Randomized Clinical Trial. Nutrients, 16(7), 1083. https://doi.org/10.3390/nu16071083
- Chedid, V., Dhalla, S., Clarke, J. O., Roland, B. C., Dunbar, K. B., Koh, J., Justino, E., Tomakin, E., & Mullin, G. E. (2014). Herbal therapy is equivalent to rifaximin for the treatment of small intestinal bacterial overgrowth. Global advances in health and medicine, 3(3), 16–24. https://doi.org/10.7453/gahmj.2014.019
- Furnari, M., Parodi, A., Gemignani, L., Giannini, E. G., Marenco, S., Savarino, E., Assandri, L., Fazio, V., Bonfanti, D., Inferrera, S., & Savarino, V. (2010). Clinical trial: the combination of rifaximin with partially hydrolysed guar gum is more effective than rifaximin alone in eradicating small intestinal bacterial overgrowth. Alimentary pharmacology & therapeutics, 32(8), 1000–1006. https://doi.org/10.1111/j.1365-2036.2010.04436.x
- Marino, M., Del Bo’, C., Martini, D., Perna, S., Porrini, M., Cherubini, A., Gargari, G., Meroño, T., Hidalgo-Liberona, N., Andres-Lacueva, C., Kroon, P. A., Guglielmetti, S., & Riso, P. (2024). A (poly)phenol-rich diet reduces serum and faecal calprotectin in older adults with increased intestinal permeability: the MaPLE randomised controlled trial. BMC geriatrics, 24(1), 707. https://doi.org/10.1186/s12877-024-05272-y
- Del Bo’, C., Bernardi, S., Cherubini, A., Porrini, M., Gargari, G., Hidalgo-Liberona, N., González-Domínguez, R., Zamora-Ros, R., Peron, G., Marino, M., Gigliotti, L., Winterbone, M. S., Kirkup, B., Kroon, P. A., Andres-Lacueva, C., Guglielmetti, S., & Riso, P. (2021). A polyphenol-rich dietary pattern improves intestinal permeability, evaluated as serum zonulin levels, in older subjects: The MaPLE randomised controlled trial. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland), 40(5), 3006–3018. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2020.12.014
- Abbasi, F., Haghighat Lari, M. M., Khosravi, G. R., Mansouri, E., Payandeh, N., & Milajerdi, A. (2024). A systematic review and meta-analysis of clinical trials on the effects of glutamine supplementation on gut permeability in adults. Amino acids, 56(1), 60. https://doi.org/10.1007/s00726-024-03420-7








